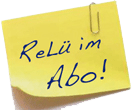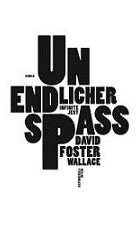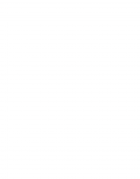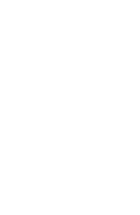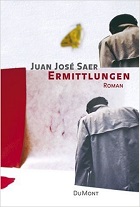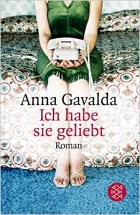Als Literaturübersetzerin und Hochschuldozentin hat Irène Kuhn die Erfahrung gemacht, dass die Leistungen der Übersetzer in der Literaturkritik viel zu wenig beachtet werden. Hier kann ihr Buch Abhilfe schaffen: Antoine Bermans Methode der Übersetzungskritik wird von ihr vorgestellt, durch ihre eigene Übersetzung zugänglich gemacht und anhand von vier deutschen Übertragungen des Baudelaire-Gedichtes Les petites vieilles auf Tauglichkeit überprüft. Damit legt Irène Kuhn die Erprobung eines neuartigen Konzeptes vor und eröffnet der Übersetzungskritik im deutschen Sprachraum neue Möglichkeiten.