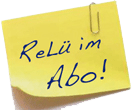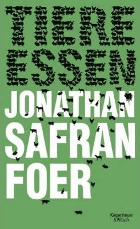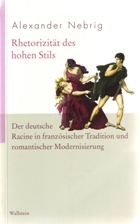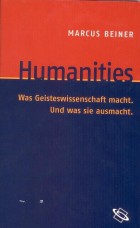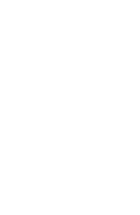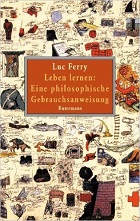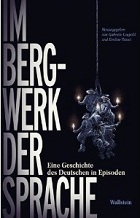
Modalpartikeln, Dialogstrukturpartikeln, Abweichungen in Syntax oder Präpositionsgebrauch, aber auch Dialekte, Archaismen, Mischsprachen und Slang: Der von zwei renommierten Literaturübersetzerinnen herausgegebene Sammelband rückt in sprachhistorischer Perspektive jene kleinen Details ins Licht, die Philologen in früherer Zeit häufig als Regelverstöße verpönten, Übersetzer jedoch oft tagelang umtreiben.