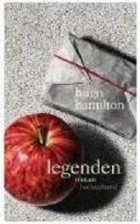„Jeder Mensch, nicht nur der Dichter, erfindet seine Geschichten – nur dass er sie, im Gegensatz zum Dichter, für sein Leben hält“, so Max Frisch in seinem Essay „Unsere Gier nach Geschichten“ (1960). In Hugo Hamiltons Legenden (Disguise) erzählt der Musiker Gregor Liedmann sich selbst und anderen die Geschichte, ein jüdisches Waisenkind zu sein, das versteckt und dann als deutscher Flüchtling getarnt aus dem Osten mitgenommen wurde. In seiner frühesten Kindheitserinnerung sitzt er in einem LKW zwischen einem dicken älteren Mann und einer Frau. Er hat eine schmerzhafte Ohrentzündung, und der Mann schenkt ihm zur Beruhigung einen roten und einen grünen Bonbon. Den roten lutscht er gleich, den grünen steckt er in die Tasche und findet ihn nie wieder – ein Verlust, der ihn noch lange schmerzt.
Die Frau, neben der er sitzt, hat in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs ihren knapp dreijährigen Sohn Gregor im Bombenhagel verloren. Ihr Vater, der dicke Mann, bringt ihr kurz darauf einen gleichaltrigen jüdischen Waisenjungen, der den verlorenen Sohn ersetzen soll. Als Gregor als Kind durch eine Bemerkung eines Onkels auf den Gedanken gebracht wird, er könnte ein Findelkind und nicht der leibliche Sohn seiner Eltern sein, hat er endlich eine Erklärung für das Gefühl der Fremdheit, das er schon sein Leben lang verspürt. Er wird argwöhnisch, sucht nach Ähnlichkeiten mit seinen Eltern, findet keine und wird sich immer sicherer, dass es stimmt: Er ist eine Waise und wird seine wahre Herkunft nie ergründen können.
„Ein Vorfall, der uns verfolgt, braucht nie geschehen zu sein“, schreibt Frisch in dem erwähnten Essay, und dieser Satz führt direkt zum Kern des Romans: Der Verlust seiner Wurzeln und das Aufwachsen als Ersatz für einen Anderen bestimmt Gregors Leben, und doch beruht all das womöglich nur auf Einbildung. Seine (Adoptiv-)Mutter jedenfalls beharrt darauf, dass Gregor ihr leiblicher Sohn sei. Es beginnt eine Spurensuche, die, Jahre später, vor allem von Gregors Frau Mara vorangetrieben wird; sie will ihrem Mann seine Identität zurückgeben und sich ihrer eigenen versichern, die von der Ehe mit einem Überlebenden des Holocaust maßgeblich geprägt ist.
Über die Wahrheit lässt Hamilton den Leser bis zuletzt im Ungewissen, und am Ende spielt sie vielleicht gar keine so große Rolle mehr. Interessanter sind die Betrachtungen zum Thema Identität, zu denen Maras Nachforschungen Anlass geben: „Überall im Haus gab es Dinge, die Gregor vertraut gewesen sein mussten. Gehörten nicht auch Kühlschrank, Fernseher und Form und Ort der Heizkörper zu seiner Identität? Das war der visuelle Teil seiner Erinnerungen.“ Gregor selbst ist sich der Konstruiertheit seiner Lebensgeschichte zuweilen durchaus bewusst: „Manchmal kann er nicht mehr zwischen seiner Erinnerung und dem unterscheiden, was man ihm erzählt hat, zwischen dem Erlebten und dem, was er in Büchern gelesen hat. Er besteht aus allem, was er gehört und gelesen hat.“
Der fragmentarische Charakter von Erinnerung und Identität spiegelt sich auf formaler Ebene wieder. In kurzen Kapiteln werden abwechselnd Szenen aus Gregors Kindheit kurz nach Kriegsende, in der Jetztzeit bei der Apfelernte auf einem Landgut sowie Begebenheiten aus Gregors Musikerleben geschildert, und doch verliert der Leser nie den Überblick. Hugo Hamilton versteht es meisterhaft, die Geschichte bis zum Schluss in der Schwebe zu lassen, immer wieder neue Details hinzuzufügen, das entscheidende jedoch zurückzuhalten.
Umso bedauerlicher ist es, dass die sprachliche Gestaltung der geschickten Konstruktion nicht ebenbürtig ist. Die ungeheure Sogkraft der ersten Seiten, auf denen die Bombardierung und der Tod des „echten“ Gregor – ob Tatsache oder Einbildung – geschildert werden, geht in den folgenden Kapiteln zu oft verloren. Hamilton verlegt sich auf einen braven Erzählton; eine echte Freude an der Sprache will sich nur selten einstellen. Bezeichnend hierfür sind Dialogpassagen wie etwa folgende:
‚My darling, Gregor‘, she said, ‚You can’t believe a word of what Uncle Max tells you.‘ Her endearments were condescending. Her denial brought out a helpless rage in him, thrashing out accusations. She told him to calm down and said he shouldn’t say such hurtful things.
An solchen Stellen wünscht man sich, Hamilton hätte sich die stilistische Maxime „Show, don’t tell“ mehr zu Herzen genommen und den Dialog fortgeführt, statt ihn zu beschreiben. Und auch dort, wo längere erzählende Passagen unvermeidbar waren, weil etwa ein längerer Zeitraum umspannt werden musste, sind Hamiltons Schilderungen oft zu sachlich und zu phantasielos, kurz – es fehlt der sprachliche Biss, das gewisse Etwas.
Dass Henning Ahrens‘ Übersetzung meist ebenso zahm klingt, ist dabei kein Fehler, sondern im Sinne der Wirkungsäquivalenz richtig und konsequent. Die ersten Seiten hingegen sind im Deutschen ebenso packend wie im Original, nicht zuletzt aufgrund mutiger Übersetzerentscheidungen. Lautet der allererste Satz bei Hamilton: „They must have been out of their minds with fear“, so steht bei Ahrens: „Sie waren kopflos vor Angst.“ Zwar geht der hypothetische Charakter der Aussage verloren, doch durch den knappen deutschen Satz wird der Leser ebenso schonungslos mit der Situation konfrontiert wie Gregors Mutter mit dem Bombenangriff – ein schlagkräftiger Romananfang, zumal die Nachbildung der englischen Satzkonstruktion im Deutschen schwerfällig gewirkt hätte. Dass Ahrens sein Handwerk beherrscht, daran kommt auch im Folgenden kein Zweifel auf. Seine Sätze fließen, seine Formulierungen sind idiomatisch sicher – aus „equally noisy in color and style“ etwa wird „ebenso überkandidelt, […] was Farben und Stil betraf“ –, und mitunter verwandelt er ein im Original gutes Bild zu einem im Deutschen brillanten: Aus „A remarkable height of friendship had come to a remarkable low“ wird „Eine bemerkenswert tiefe Freundschaft war auf bemerkenswert flachen Grund gelaufen.“ Stellenweise gerät die Übersetzung poetischer als das Original, etwa wenn Mara nach dem Erhalt eines Briefes „wie in sich eingesponnen“ ist, während es im Original nüchterner heißt: „She […] remained inside her own world.“ Hier merkt man, dass Henning Ahrens nicht nur Übersetzer, sondern auch Schriftsteller und Lyriker ist (im Frühjahr 2008 erschien sein neuester Gedichtband Kein Schlaf in Sicht).
Doch hoppla, was ist das? „Eine solche Arbeit passte nicht wirklich zu ihm“, liest man und staunt: Der sprachgewandte Ahrens verwendet einen Anglizismus wie „nicht wirklich“. Aber vielleicht zeigt sich hier, was Gunhild Kübler in Sprache im technischen Zeitalter (2003)[1] konstatiert: dass Autoren (in diesem Fall übersetzende Autoren) mit der deutschen Sprache oft unverkrampfter umgehen als Übersetzer. Denn wenn man ehrlich ist, lässt sich kaum bestreiten, dass die Wendung „nicht wirklich“ längst Einzug in die deutsche Sprache gehalten hat. Nur leistet sich ein Schriftsteller vielleicht eher solche sprachlichen Verstöße (?), weil ihm nicht wie einem Übersetzer sofort von der Kritik auf die Finger geklopft wird, wie Kübler beobachtet. Zwar sähe man statt „nicht wirklich“ lieber „eigentlich nicht“, aber man könnte darüber nachdenken, ob man nicht auch Übersetzern mehr Bewegungsspielraum zugestehen und zulassen sollte, dass sich der in der Alltagssprache längst erfolgte Wandel auch in übersetzter Literatur niederschlägt. Wie man dazu steht, hängt jedoch maßgeblich vom übersetzerischen Selbstverständnis ab – sieht man sich als Sprachpfleger oder eher als Sprachdokumentar? – und ist also auch eine Identitätsfrage.
Apropos: Gegen Ende des Romans erfährt man, dass die Mutter Gregor den grünen Bonbon damals, als er wegen seiner Ohrentzündung wimmerte, in den Mund gesteckt hatte, woraufhin er sich sofort beruhigte. In Erinnerung blieb Gregor nur der schmerzliche Verlust des Bonbons – ebenso wie der schmerzliche Verlust seiner Identität, der mit jener verhängnisvollen Andeutung des Onkels beginnt und für den Gregor vor allem seine (Adoptiv-)Mutter verantwortlich macht. Dass sie dem namenlosen Waisenjungen, als der er sich sieht, „a new identity and a new, ready-made biography“ schenkte, hat er ebenso vergessen wie jene Minuten, in denen er, von ihr gewiegt, den grünen Bonbon lutschte.
Hugo Hamilton: Legenden, übersetzt von Henning Ahrens, München: Luchterhand 2008, 303 Seiten, 19,95 €
Hugo Hamilton: Disguise, London: Fourth Estate 2008, 261 Seiten, ca. £ 13
Hugo Hamilton wurde 1953 als Sohn einer Deutschen und eines Iren in Dublin geboren. Er arbeitete zunächst als Journalist, bevor er Kurzgeschichten und Romane veröffentlichte. 2003 feierte er großen Erfolg mit seinen deutsch-irischen Kindheitserinnerungen The Speckled People (dt. 2004, Gescheckte Menschen), die in fünfzehn Sprachen übersetzt wurden. Disguise, dt. Legenden, ist sein fünfter Roman.
Henning Ahrens, geb. 1964, lebt als Schriftsteller und Übersetzer in der niedersächsischen Provinz. Für seine Lyrik wurde er bereits mehrfach ausgezeichnet. Er übersetzte u.a. J. C. Powys, Jonathan Safran Foer, Jonathan Coe und Hugo Hamilton. Zuletzt erschien sein Lyrikband Kein Schlaf in Sicht und der Roman Tiertage.
Stefanie Jacobs hat im Herbst 2007 den Diplomstudiengang Literaturübersetzen abgeschlossen und arbeitet seitdem als freie Übersetzerin (bisher unter dem Namen Stefanie Röder). Während des Studiums lebte und arbeitete sie längere Zeit in Frankreich. Sie übersetzt Autoren wie Benjamin Kunkel, Ronan Bennett, Frances de Pontes Peebles, Marion Ruggieri und Nick Cave. Weitere Informationen unter www.stefanieroeder.de
[1] Gunhild Kübler: „Deutsch mit Bügelfalten“, in: Sprache im technischen Zeitalter 166, 07/2003, 194-198.