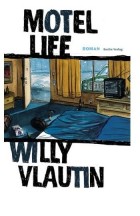Über die Art, wie man in deutscher Sprache zu fluchen hat, kann man sicherlich streiten. Aber, ob durch MTV, amerikanische Filme oder schlicht den schnellen Wandel der Umgangssprache, eins ist klar: Wir fluchen immer „englischsprachiger“. Doch es geht auch anders. Robin Detje, der Übersetzer des Romandebüts Motel Life von Willy Vlautin zeigt, dass es für das englische „fucking“ außer einem nervigen „verdammt“ oder einem einfallslosen „verfickt“ würdigere Übersetzungen gibt. Und das ist nicht der einzige Genuss, der beim Lesen aufkommt, wenn Detje in seiner Übersetzung lexikalisch aus dem Vollen schöpft.
Doch zunächst zum Inhalt: „In der fraglichen Nacht war ich betrunken, fast schon bewusstlos, und ich schwöre bei Gott, ein Vogel hat mir das Motelzimmerfenster eingeschlagen“. Frank, der Erzähler des Romans, wirft den toten Vogel zurück auf die Straße und legt sich kurzerhand wieder ins Bett, um seinen Rausch auszuschlafen. Er wird wach, als Jerry Lee, auch nicht ganz nüchtern, vor seinem Bett steht. Der hat mitten in der Nacht einen kleinen Jungen totgefahren. Verzweifelt hat er ihn auf den Rücksitz seines Autos gelegt und sich auf dem Weg zu seinem Bruder gemacht, der ihm helfen soll.
In Motel Life begleitet der Leser die beiden Brüder auf ihrer anschließenden Flucht aus der Heimatstadt Reno. Sie scheitern, wie bereits so oft in ihrem Leben, und kehren nach wenigen Tagen wieder nach Hause zurück. In kleinen Episoden erfahren wir, dass Frank und Jerry Lee im Grunde nie eine richtige Chance hatten. Der Vater, spielsüchtig, wie so ziemlich jeder in der kleinen Spielerstadt im US-Bundesstaat Nevada, verlässt nach einem Gefängnisaufenthalt die Familie. Die Mutter stirbt, als Frank fünfzehn ist. Die Brüder schmeißen die Schule, halten sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser und leben seit dem Tod ihrer Mutter, na wo? – in Motels.
Der Autor des Romans, Willy Vlautin, ist Musiker, Sänger und Liedtexter der amerikanischen Folkrockband Richmond Fontaine. Diesen ersten Roman hat er im Stil eines Roadmovie geschrieben; ein Genre, das vom Unterwegs- und Auf-der-Suche-Sein der Helden handelt und in dem die Stimmung vor allem durch die jeweilige Filmmusik getragen wird. Es kommt also nicht von ungefähr, dass die Protagonisten ständig Musik hören – und zwar eine ganz bestimmte. Immer wieder bittet Jerry Lee seinen Bruder „Schieb mal das Willy Nelson Tape rein, ja?“. Der Countrysänger Willy Nelson steht, als Vertreter der amerikanischen „Outlaw-Bewegung“ der 1970er Jahre, symbolisch dafür, was Frank und Jerry Lee durchmachen. Und so wundert es nicht, dass Letzterer auf der Flucht aus Reno sagt, er habe „immer wieder dieses Lied Railroad Lady im Ohr“, ein Song Nelsons, in dem eine junge Frau besungen wird, die ihre Tage im Zug verbringt und eigentlich nur eines will: zurück nach Hause.
In dem Roman herrscht ein umgangssprachlicher Ton. Die Dinge können mal „a fucking fortune“ kosten, ein Typ „a son of a bitch“ und das Leben ein „shithole“ sein. Jedoch gibt es auch andere Abschnitte: traurige Passagen, in denen Frank beispielsweise vom letzten gemeinsamen Abendessen mit der Mutter erzählt oder davon, wie Jerry Lee als Kind beim Sprung auf einen Eisenbahntransport ein Bein verlor. Oder wenn es um Jerry Lees immer wiederkehrende Schuldgefühle wegen des getöteten Jungen geht. Nicht zuletzt rührt auch die Liebesgeschichte zwischen Frank und Annie James. Grundsätzlich wird aber vor, nach oder bei jeder Entscheidung erstmal ein Bier oder ein Whisky getrunken, gern auch beides. Und wenn gar nichts mehr geht, muss eben das Willy Nelson Tape her.
Man möchte den Kopf schütteln und kann sich doch des Mitgefühls nicht entziehen. Zu sympathisch sind die Figuren, zu tragisch ihre Vergangenheit und Gegenwart, zu hinreißend naiv Jerry Lees Ideen, mit denen er den Unfall gutzumachen versucht, zu urkomisch Franks Geschichten, mit denen er die Menschen um sich herum aufheitert.
Die Herausforderung an den Übersetzer besteht nicht darin, komplexe Satzstrukturen aufzulösen und Metaphern zu übertragen. Die Kunst liegt vielmehr darin, den umgangssprachlichen Ton des Originals zu treffen, ohne dabei in ein Register abzugleiten, das die traurigen und ernsten Momente unglaubwürdig erscheinen lässt. ‚Irgendwie amerikanisch‘ sollte es klingen, schließlich leben Frank und Jerry Lee nicht nur in Amerika sondern auch fast ausschließlich in Motels. Detje schreckt in seiner Übersetzung weder davor zurück, englische Begriffe im Text zu belassen, noch sich des Neudeutschen zu bedienen, wo es passt. So geht Frank häufig im „Diner“ essen, kauft die Salbe im „Drugstore“ und hasst es, immer dann an Annie James zu denken, wenn er „down“ ist, oder es wird eben „Cash“, kein Bargeld, benötigt. Und das ist auch gut so, verleiht dies der Übersetzung doch das Erfrischende und sprachlich Zeitgemäße.
Detjes Übersetzung zeigt eine angenehme Ausgewogenheit von rauem Umgangston und Prosasprache. Manches wirkt derber, wenn beispielsweise aus einem unmarkierten „She drank herself to death“ ein umgangssprachliches „Sie hat sich totgesoffen“ wird. Anderes hingegen hat der Übersetzer ein wenig geglättet, ohne der Bedeutung des Originals in irgendeiner Weise nachzustehen: „Und der Mief in diesem Laden“ für „And the fucking smell of that place“ zeigt, dass Detje es sich nicht leicht gemacht hat. Ein „scheiß Gestank“ hätte es ja auch getan, aber man freut sich über eine kurze sprachliche Entspannungspause. Erwähnenswert sind auch schlicht und einfach gelungene Passagen: „Both our moods were pretty dark“, „Wir waren beide ziemlich finster drauf“, ist so ein Beispiel.
Und wo wurde noch aus dem Vollen geschöpft? Überall dort, wo das Original relativ unmarkiert daherkommt, bei Verben wie „to drink“, „to sleep“, „to cry“, um nur einige zu nennen. Hier nutzt er die deutsche Umgangssprache und setzt sie überall ein, wo dies möglich ist, ohne zu übertreiben. Da wird gepennt, ein Nickerchen gehalten, oder eben auch mal einfach nur geschlafen. Es wird natürlich viel gesoffen und zugegebenermaßen eher selten einfach getrunken – aber auch. Schließlich und auch das soll hier nicht unerwähnt bleiben: Es wird oft geheult, stellenweise richtig geflennt und dann mal wieder geweint.
Zu guter Letzt noch ein Beispiel für deutsches Fluchen: Als Frank und sein Sportkamerad sich prügeln, geht das natürlich nicht ohne Worte vonstatten: „‚You son of a bitch‘, I said. ‚Fuck you‘, the kid said back.“ „‚Du altes Arschloch‘, sagte ich. ‚Leck mich‘, gab der Junge zurück.“ Ja, habe ich da gedacht, genau das würden deutsche Jungen sich entgegenschleudern, zumindest die, die noch nicht in den Genuss schlecht synchronisierter Filme gekommen und in einem Alter sind, in dem sie im Gegensatz zu „Hurensohn“ und „Fick dich“ bei „du altes Arschloch“ und „Leck mich“ wohl ziemlich genau wissen, was sie da aus vollem Herzen von sich geben. Danke, Robin Detje.
Ein kurzer Nachtrag: Offen bleibt, warum die letzten drei Zeilen des Originals in der Übersetzung nicht übernommen wurden. Dort steht: „Written by Frank Flannigan December 10-29 at the Terrace Park Apartment Building, Elko, Nevada. Drawings and sketches by Jerry Lee Flannigan.“ Im englischsprachigen Original ergibt sich daraus die Frage, ob man nun über Franks Leben oder aber eine seiner Geschichten gelesen hat. Dieses postmoderne Spiel um Fakten und Fiktion entgeht dem deutschen Leser.
Willy Vlautin: Motel Life, übersetzt von Robin Detje, Berlin: Berlin Verlag 2008, 207 Seiten, 17 €
Willy Vlautin: The Motel Life, London: Faber and Faber 2007, 206 Seiten, £ 7,99
Willy Vlautin, geboren 1967 in Reno, Nevada, ist Sänger und Songschreiber der Folkrockband Richmond Fontaine. Für seine Musik und seine Romane wird er gleichermaßen hoch gelobt. The Motel Life aus dem Jahr 2007 ist sein schriftstellerisches Debüt. Der zweite Roman Northline (2008) ist im Februar 2009 in Deutschland erschienen, ins Deutsche ebenfalls von Robin Detje übersetzt. Zurzeit arbeitet Vlautin an seinem achten Album (2009) und seinem dritten Roman (2010).
Robin Detje ist Autor und Übersetzer. Er wurde 1964 in Lübeck geboren und lebt heute in Berlin und New York. Nach einer Schauspielausbildung und Theaterarbeit schrieb er unter anderem für Die Zeit und die Süddeutsche Zeitung und übersetzte und inszenierte Theaterstücke. 2002 erschien sein Buch Castorf – Provokation aus Prinzip, ein Portrait des in der DDR geborenen Intendanten und Regisseurs Frank Castorf. Heute arbeitet Robin Detje ausschließlich als Übersetzer.
Katrin Goldenstein ist studierte Betriebswirtin und hat sich nach 10 Jahren Tätigkeit in der freien Wirtschaft im Oktober 2005 beruflich umorientiert. Sie studiert zurzeit Literaturübersetzen an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf mit den Sprachen Englisch und Spanisch.